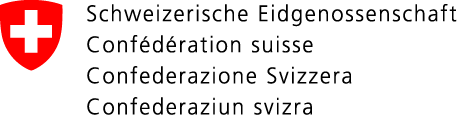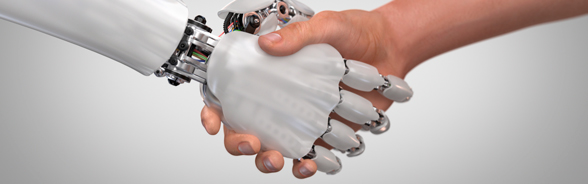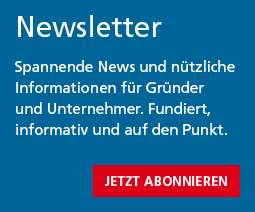Dank ihrer Fähigkeit zur Datenverarbeitung bietet die künstliche Intelligenz den Schweizer Unternehmen neue Chancen.
Definitionen und Anwendungsbeispiele
Künstliche Intelligenz (KI) soll die Fähigkeiten menschlichen Denkens imitieren. Mit dem Begriff werden sämtliche Technologien und Theorien bezeichnet, welche die menschliche Intelligenz simulieren können. So kann die KI im Gegensatz zu klassischen IT-Programmen riesige Datenmengen (Big Data) verarbeiten und analysieren.
Die Grundlagen der KI wurden bereits in den 1950er Jahren unter anderem durch Alan Turing gelegt. Seitdem entwickelt sich die KI ständig weiter, da sie Erfahrungen nach dem Prinzip des "Machine Learning" sammelt. Diese Methode des Lernens durch Fehler gleicht einer kontinuierlichen Weiterbildung: Je mehr qualitativ hochwertige Daten eine KI erhält, desto besser kann sie Muster erkennen und sich verbessern, wodurch sie anschliessend komplexe Probleme analysieren und lösen und sogar Vorhersagen treffen kann.
Google, Microsoft, Facebook – alle grossen Unternehmen nutzen heutzutage künstliche Intelligenz. Immer mehr Schweizer KMU setzen ebenfalls auf künstliche Intelligenz. Im Jahr 2024 hatten bereits mehr als die Hälfte von ihnen (55%) KI in ihre Arbeitsprozesse integriert, wie eine von AXA in Auftrag gegebene Arbeitsmarktstudie des Forschungsinstituts Sotomo zeigt.
Spracherkennung ist zum Beispiel seit einigen Jahren auf Erfolgskurs. "Chatbots" werden zunehmend eingesetzt, um rund um die Uhr einen sofortigen Kundenservice zu gewährleisten. Einige KI dienen auch dazu, HR-Aufgaben zu automatisieren und zu beschleunigen. Ein weiteres Beispiel für die Nutzung ist die automatische Steuerung eines Netzes (Wasser, Ampeln, Strassenbeleuchtung usw.).
Die Debatte über den Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt besteht seit ihren Anfängen und wurde durch jüngste Fortschritte erneut intensiviert. Der Einsatz von Menschen bleibt jedoch unverzichtbar, um die Maschine zu programmieren, die richtigen Kriterien einzuspielen und ihr "die richtigen Fragen zu stellen". Damit die KI wirklich nützlich sein kann, ist also eine Zusammenarbeit mit dem Menschen unerlässlich. Trotz der erwarteten Effizienzsteigerungen plant laut der AXA-Studie nur eine Minderheit der KMUs einen Personalabbau aufgrund von KI.
Chancen für Schweizer Firmen
Von der Bewertung finanzieller Risiken bis zur Unterstützung bei medizinischen Diagnosen betrifft KI alle Branchen. Diese technologische Wende kann für die Unternehmen eine erhebliche Effizienzsteigerung bedeuten, da die KI in der Lage ist, sehr schnell sehr viele Daten zu sortieren, sie aber auch zu organisieren und langfristig nutzbar zu machen. Sie ermöglicht zudem eine rasche und personalisierte Antwort an die Kunden und Vorhersagen über potenzielle Käufe eines Kunden auf dem Internet. Eine Studie der Innovate Switzerland Community unter 111 Unternehmensvertretern ergab, dass die Mehrheit der Befragten (68%) in den nächsten fünf Jahren mit einer Produktivitätssteigerung durch KI rechnet. Mehr als ein Viertel (27 %) erwartet sogar einen deutlichen Anstieg.
Nach der Einführung generativer KI im Jahr 2023 veröffentlichten Microsoft und LinkedIn den Work Trend Index 2024 zur KI-Nutzung am Arbeitsplatz. Angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels zeigt der Index, dass Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden KI-Tools und Schulungen ausstatten, die besten Talente gewinnen werden. LinkedIn-CEO Ryan Roslansky betont den Wettbewerbsvorteil von Unternehmen, die "Beweglichkeit über den Status quo stellen und in die Weiterentwicklung der Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden investieren".
Zur Vertiefung
"Künstliche Intelligenz verstehen", Ralf T. Kreutzer, Marie Sirrenberg, (2023), Verlag Springer Gabler.
"Künstliche Intelligenz: Was steckt hinter der Technologie der Zukunft?", Gerhard Paass, Dirk Hecker, (2021), Verlag Springer Vieweg.
"3 minutes pour comprendre 50 avancées majeurs de l’intelligence artificielle", Luis de Miranda, (2019), Editions Le Courier du Livre.