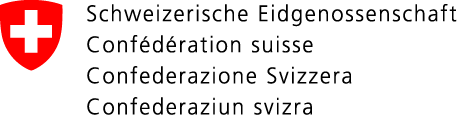Wie kann man eine effiziente Strategie entwickeln, um KI-Tools in sein KMU einzubinden? Wie lässt sich die Nutzung dieser Technologien optimieren und wie wappnet man sich gegen die damit verbundenen Risiken? Experten teilen ihre Ratschläge.

Die KI kann ganze Bereiche eines Unternehmens transformieren: Indem sie grosse Datenmengen analysiert, kann sie die Marktforschung verbessern, die Kundenbeziehungen persönlicher gestalten, aber auch Produktions- oder Rekrutierungsverfahren optimieren.
Trotz grosser Ambitionen in diesem Bereich haben die Schweizer KMU jedoch Schwierigkeiten, diese Tools in ihre Strategien einzubinden, um eine effiziente Umsetzung zu gewährleisten. Das zeigt eine 2024 von der Fachhochschule für Wirtschaft (HEG) Genf publizierte Studie, die gemeinsam mit der Firma Oracle und der Agentur Colombus Consulting erstellt wurde. Wie geht man am besten vor? Wie sollte man insbesondere die Nutzung von generativer KI eingrenzen? Wie kann man sich vergewissern, dass sich die Beschäftigten diese Technologien angstfrei aneignen? Tipps von zwei Fachleuten.
Anwendungsfälle identifizieren
Um den Mehrwert von KI-Tools in der eigenen Firma sicherzustellen, sollte man zunächst einmal genau festlegen, wofür sie genutzt werden sollen. "Der Begriff KI umfasst eine ganze Bandbreite an Instrumenten und die beliebtesten sind nicht automatisch diejenigen, die am besten zu den Bedürfnissen des Unternehmens passen", erläutert Alexandre Caboussat, Professor an der HEG Genf und Co-Autor der Studie zum Einsatz von KI in der Schweiz, die 2024 erschienen ist. Systeme mit generativer KI wie ChatGPT, DeepSeek, Perplexity oder Dall-E sind leistungsstarke Hilfsmittel für die Erstellung von Texten oder die Automatisierung bestimmter Aspekte im Kundenservice. Damit sie funktionieren, ist jedoch eine hohe Rechenleistung erforderlich und ihr Anwendungsbereich ist oft auf Allgemeines beschränkt. Einfachere KI-Programme, die für spezifische Zwecke entwickelt werden oder mit den Daten des Unternehmens trainiert werden, können sich daher als deutlich wirksamer erweisen. In der Industrie gibt es KI-Systeme, die mit "Limited Memory" bezeichnet werden, beispielsweise ein von Project Bonsai von Microsoft entwickeltes Tool oder die Sensoren von Keyence. Diese nutzen Tausende von Fotografien, die am Ende der Produktionskette aufgenommen werden, wodurch zum Beispiel bei einer Qualitätskontrolle fehlerhafte Produkte rasch erkannt werden können.
Bestandsaufnahme durchführen
Vor der Implementierung muss sich das Unternehmen vergewissern, dass seine Daten mit den Tools, die es nutzen möchte, kompatibel sind. Je nach Art der gewählten KI und der angestrebten Nutzung gibt es unterschiedliche Anforderungen. "Manchmal müssen die Prozesse angepasst werden, damit die Daten systematisch in einem Format generiert werden, das von der künstlichen Intelligenz ausgewertet werden kann", ergänzt Mascha Kurpicz-Briki, Professorin für Informatik an der Berner Fachhochschule (BFH). Wenn die Daten sehr spezifisch auf eine Branche oder einen Beruf zugeschnitten sind, ist es zudem häufig besser, sie intern zu verarbeiten, anstatt diese Aufgabe an externe Unternehmen zu delegieren. Das gilt beispielsweise für den Gesundheitsbereich, wo die Auswertung von MRT-Bildern ein hohes Mass an medizinischem Fachwissen erfordert, oder in der Uhrenindustrie, wo die Analyse von hochauflösenden Bildern einzelner Komponenten auf Qualitätskriterien beruht, die jede Firma für sich festlegt.
Rahmen definieren
"Nach der ersten Welle der Begeisterung wird KI heute überlegter, aber auch kritischer eingesetzt", erklärt Alexandre Caboussat. Der Experte rät Unternehmen, einen Rahmen für die Möglichkeiten und Grenzen aufzustellen, in denen die neuen Tools genutzt werden können, und zugleich die Mitarbeitenden von Anfang an bei der Einbindung zu begleiten. Der Vorteil dieses Ansatzes ist auch, dass bei Beschäftigten mit besonders vielen Vorbehalten die Angst verringert wird, durch eine Maschine ersetzt zu werden, und dass klargestellt werden kann, wie die verschiedenen Programme zu nutzen sind.
Teams schulen
"Die Mitarbeitenden müssen die Grundprinzipien des Machine Learning verstehen. Generative KI weist verschiedene Arten von Risiken im Zusammenhang mit ihrer Funktionsweise auf, zum Beispiel die Erzeugung von Falschinformationen (bei Chatbots "Halluzinationen" genannt) oder die Reproduktion bzw. sogar Verstärkung von gesellschaftlichen Stereotypen. Es ist also wichtig, dass die Mitarbeitenden dies erkennen können", gibt Mascha Kurpicz-Briki zu bedenken. Verschiedene Schweizer Institutionen wie die HES-SO, die Universität Genf oder privatwirtschaftliche Unternehmen wie Lumind oder MCJS bieten Schulungsprogramme für die Belegschaft von Unternehmen an.
Auswirkungen messen
Nachdem die KI in das Unternehmen eingebunden wurde, geht es darum, die Auswirkungen auf die Rendite und die Wertschöpfung zu messen. Diese sind jedoch schwer zu quantifizieren: "Die Wahrnehmung des Nutzens und der Rentabilität hängt vom Anwendungsfall ab. Es ist daher problematisch, eine Fertiglösung anzubieten. Zudem kann es für KMU schwierig sein, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, weil sich die Technologie sehr rasch verändert", sagt Mascha Kurpicz-Briki. Auch hier können Kooperationen mit der akademischen Welt bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen. Das Generative AI Lab der BFH bietet beispielsweise Machbarkeitsstudien an. Deren Ziel besteht darin, die Daten und Prozesse eines KMU zu analysieren, um Bereiche ausfindig zu machen, in denen die Nutzung der KI noch optimiert werden kann.
Die Definition der Anwendungsfälle von KI, die Sicherstellung einer Datenbasis, die mit den gewählten Tools kompatibel ist, und ein klarer Rahmen für die Nutzung durch die Mitarbeiter sind die Ausgangspunkte für eine effektive Einführung von KI in Unternehmen. Um einen sicheren und optimalen Einsatz zu gewährleisten, müssen anschliessend gezielte Schulungen für die Mitarbeiter durchgeführt und die mit den Tools erzielten Leistungen kontinuierlich bewertet werden. Auf diese Weise kann KI auch in einem sehr dynamischen Umfeld wie dem von kleinen und mittleren Unternehmen äußerst relevant sein und zur Wertschöpfung beitragen.
Informationen
Zum Tema
Wäre ein Verbot generativer KI eine gute Idee?
Alexandre Caboussat, Professor an der Hochschule für Verwaltung Genf, antwortet mit einem klaren Nein: "Es handelt sich um eine Technologie, die von Dauer sein wird. Es bringt nichts, sie zu bekämpfen. Die Herausforderung besteht vor allem darin, ihr einen Rahmen zu geben und problematische Anwendungen zu definieren." Diese Ansicht teilt auch Mascha Kurpicz-Briki, Professorin für Informatik an der Berner Fachhochschule (BFH): "Die Unternehmen müssen definieren, an welchen Stellen ihrer Prozesse es sinnvoll ist, generative KI einzubinden, und wie das geschehen soll. Einige von ihnen sollten zum Beispiel interne Lösungen bevorzugen, damit ihre Daten nicht über Internet-Plattformen gegenüber Dritten preisgegeben werden. In jedem Fall ist es entscheidend, dass sich die Beschäftigten der Risiken und Grenzen dieser Technologien bewusst sind, damit sie sie verantwortungsvoll und im Interesse des Unternehmens nutzen."
Links
Letzte Änderung 07.05.2025