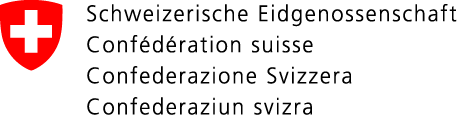Tools, die mit generativer künstlicher Intelligenz arbeiten, bieten Unternehmen jede Menge Vorteile, bringen aber auch rechtliche Unsicherheiten mit sich. Wie lassen sich die Risiken begrenzen, insbesondere mit Blick auf die Wahrung des Urheberrechts? Antworten von Sabrina Konrad, Juristin am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum.
Knapp die Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz haben begonnen, künstliche Intelligenz (KI) in ihre Prozesse einzubinden, wie aus einer Studie der AXA Versicherung und des Forschungsinstituts Sotomo hervorgeht. Neben der Übersetzung und dem Verfassen von Texten nutzen mehr als ein Drittel der Firmen diese neuen Technologien auch für das Erstellen von Werbeanzeigen und knapp ein Viertel für die Erzeugung von Bildern für ihre Website oder ihre PR-Massnahmen. Mit diesem Vorgehen kann man Kosten sparen und erhält innert kürzester Zeit Zugang zu einer breiten Auswahl an Vorschlägen. Aber was ist mit dem Urheberrecht? Ein Unternehmen darf das Bild einer berühmten Persönlichkeit nicht zu Werbezwecken verfremden, zum Beispiel indem es James Bond mit einer Patek Philippe ausstattet. In welchem Rahmen kann man unverfänglich auf Bilder zurückgreifen, die von diesen Tools generiert werden? Erklärungen dazu liefert Sabrina Konrad, stellvertretende Leiterin des Rechtsdienstes "Urheberrecht" beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE).
Welche Risiken gehen Unternehmen ein, wenn sie Bilder oder Texte verwenden, die durch künstliche Intelligenz generiert wurden?
Sabrina Konrad: In Abhängigkeit von der Qualität des Tools, seiner Funktionsweise und den verwendeten Prompts (Anm. d. Red.: Anweisungen oder Datenreihen, mit denen ein KI-System gefüttert wird) kann es sein, dass die KI Inhalte generiert, in denen urheberrechtlich geschützte Elemente vorkommen. Den Unternehmen können in dem Fall zivilrechtliche oder sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen.
Es ist ratsam zu prüfen, ob rechtliche Ausnahmen wie das Zitatrecht gelten, und gegebenenfalls die Quelle zu nennen. Im Zweifelsfall können Unternehmen auch eine Internetrecherche durchführen oder Tools zur Plagiatsprüfung nutzen.
Wem gehören Inhalte, die von Plattformen wie Midjourney oder DALL·E erstellt wurden?
Konrad: Das kommt darauf an. Unternehmen müssen die Nutzungsbedingungen der Plattformen lesen, die die Verwendung des Outputs (Anm. d. Red.: von der KI generierte Inhalte) einschränken können. Nach den aktuellen Regeln von Midjourney gehören die erzeugten Bilder beispielsweise der Person oder der Firma, die sie erstellt, und können von ihr ohne Erwähnung der Plattform verwendet werden. Es gibt jedoch Ausnahmen. So muss ein Unternehmen, dessen Umsatz mehr als eine Million Dollar pro Jahr beträgt, ein besonderes Abonnement abschliessen. Hinzu kommt, dass die Nutzung eingeschränkt sein kann, wenn das generierte Bild das Ergebnis einer hochauflösenden Umwandlung eines bestehenden Bildes ist.
Juristisch gesehen darf man diese Inhalte nicht verwenden, wenn Urheberrechte verletzt werden. Die Unternehmen müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass einige Plattformen die durch sie generierten Inhalte zum Training der KI oder zu anderen Zwecken wie Werbung weiterverwenden können.
Gibt es rechtliche Unterschiede zwischen einem durch KI generierten Inhalt und einem von einem Menschen geschaffenen Inhalt?
Konrad: In der Schweiz sind nur die von einem Menschen geschaffenen Inhalte durch das Urheberrecht geschützt. Ein mit KI generierter Inhalt ist nicht automatisch von diesem Schutz abgedeckt. Wenn der Nutzer den Output jedoch beeinflusst oder eine wesentliche Änderung daran vornimmt, kann er Schutzrechte für sich beanspruchen. Denn in diesem Fall nutzt er die KI nur als Werkzeug. Es gibt allerdings keine klar definierte Schwelle wie zum Beispiel 60% Änderung. Im Moment muss jeder Fall einzeln geprüft werden.
Wie kann die Justiz bei einem Rechtsstreit gegenwärtig entscheiden?
Konrad: In der Schweiz gibt es meines Wissens noch kein Urteil zu diesem Thema. In anderen Ländern, unter anderem in den USA und in Deutschland, wurden schon einige Entscheidungen in Bezug auf die Frage der Nutzung geschützter Inhalte für das Training von KI gefällt. Würde ein solcher Fall vor einem Schweizer Gericht landen, würde dieses im Zuge seiner Entscheidung wahrscheinlich nicht nur das Schweizer Recht prüfen, sondern auch die ausländische Rechtsprechung.
Gibt es in der Schweiz Richtlinien für die Nutzung von generativer KI in Unternehmen?
Konrad: Nein, aber der Bundesrat hat Empfehlungen für die Bundesverwaltung veröffentlicht, die als Orientierung dienen können. Das KI-Gesetz der Europäischen Union ("EU AI Act") ist auch ein relevanter Referenzrahmen für die Schweizer Unternehmen, insbesondere für diejenigen, die KI-basierte Produkte oder Dienstleistungen auf dem europäischen Markt anbieten.
Ist die Angabe, dass ein Inhalt mit KI generiert wurde, Pflicht?
Konrad: Es gibt keine strenge gesetzliche Verpflichtung, aber einige Anbieter wie OpenAI verlangen, dass der Ursprung der Inhalte unter bestimmten Voraussetzungen erwähnt wird. Für ein Unternehmen kann es das Vertrauen der Kunden und der Mitarbeiter stärken, wenn auf diesem Gebiet Transparenz hergestellt wird. Wichtig ist auch, dass man über die firmeninterne Nutzung von KI Bescheid weiss, damit man eine kohärente Strategie definieren kann.
Welche Tipps können Sie einem KMU geben, das sich mit diesen Fragen beschäftigt?
Konrad: Entscheidend ist, dass man sich informiert, bevor man diese Tools nutzt, besonders indem man die Nutzungsbedingungen liest, um die Auswirkungen im Hinblick auf Daten und Urheberrecht zu verstehen. Es geht auch darum, die Rechtmässigkeit des Outputs zu überprüfen. Darüber hinaus kann es sein, dass die KI Vorurteile reproduziert oder fragwürdige Inhalte generiert. Es ist wichtig, dass man wachsam bleibt, was Ethik und Qualität angeht. KI ist ein sehr leistungsfähiges Instrument, aber ihre Nutzung muss vorsichtig und überlegt erfolgen.