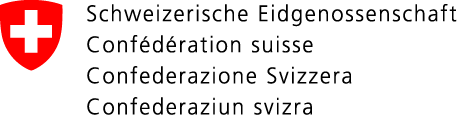Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union wurden im Dezember 2024 inhaltlich abgeschlossen und mündeten in die "Bilateralen III". Lohnschutz, Schutzklausel, Mitsprache bei der Ausarbeitung des Rechts: Christa Tobler, Expertin für Europarecht, erklärt die wichtigsten Punkte des neuen Vertragspakets.
Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens 2021 waren die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) in eine Sackgasse geraten. Im März 2024 wurden daher wieder Verhandlungen aufgenommen, um den Zerfall der vor einigen Jahrzehnten unterzeichneten Abkommen zu verhindern und die strategische Partnerschaft zwischen der Eidgenossenschaft und ihrem wichtigsten Handelspartner zu stärken. Im Dezember letzten Jahres kam dieser Prozess zum Abschluss. Bei knapp 140 bilateralen Abkommen, die es zu prüfen gilt, sollen die künftigen Beziehungen zwischen den beiden Parteien in verschiedenen Bereichen wie Strom, Personenfreizügigkeit, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit durch einen Paketansatz geregelt werden. Die genaue Ausgestaltung wird im Laufe des Jahres 2025 veröffentlicht, doch einige Elemente sind schon bekannt. Ein Gespräch mit Prof. Christa Tobler, Expertin für die rechtlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU.
Inwiefern schützen die Bilateralen III die Interessen der Schweiz besser als das 2021 abgebrochene Rahmenabkommen?
Christa Tobler: Das neue Paket deckt mehr Bereiche ab und sieht mehr Anpassungen an die Schweizer Besonderheiten vor. Diese Ausnahmen ergeben sich nicht aus dem EU-Recht, sondern wurden speziell für den Fall der Schweiz ausgehandelt. Dies gilt zum Beispiel für den Lohnschutz oder die Migrationspolitik.
Welche Lösungen bieten die Bilateralen III für die Befürchtungen hinsichtlich des Lohndumpings?
Tobler: Die Bilateralen III bestätigen das Schweizer Kontrollsystem des Arbeitsmarktes, das beim Inkrafttreten des Abkommen über die Freizügigkeit (FZA) im Jahr 2002 beschlossen wurde, mit einer dreiseitigen Überwachung durch die Kantone, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Es sind einige Anpassungen geplant: Z.B. soll die Frist für die Voranmeldung von entsandten Arbeitnehmenden von 8 Kalendertagen auf 4 Werktage geändert werden. Man muss jedoch beachten, dass es in den anderen Staaten, die Vertragsparteien dieses Abkommens sind, keine solchen Meldefristen gibt und es sich somit um eine Schweizer Besonderheit handelt. Aufgrund der neuen digitalen Kommunikationsmittel bleibt diese Verkürzung m.E. grundsätzlich mit dem Arbeitnehmerschutz kompatibel. In Bezug auf die Erstattungen von beruflichen Ausgaben möchte die Schweiz, dass diese an den Lebenshaltungskosten vor Ort ausgerichtet werden. Bisher scheint sich Brüssel dem nicht entgegenzustellen. Einige EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, haben hierfür bereits Ausnahmeregelungen eingeführt.
Das FZA enthält eine Schutzklausel, die es ermöglicht, die Zuwanderung temporär zu begrenzen, falls "schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Probleme" vorliegen. Wie geht man in den Bilateralen III mit diesem Mechanismus um?
Tobler: Das aktuell gültige Abkommen sieht vor, dass Schutzmassnahmen nur dann getroffen werden können, wenn beide Seiten der Ansicht sind, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, was es der EU ermöglicht, das Verfahren einseitig zu blockieren. Mit den Bilateralen III ist das nicht mehr möglich. Wenn eine Seite die Aktivierung der Klausel fordert, müssen sich beide vor dem Gemischten Ausschuss einigen. Wird keine Einigung erzielt, kommt die Sache vor ein Schiedsgericht, das dann eine Entscheidung fällt. Diese Sicherheitsmassnahme käme jedoch nur in Ausnahmefällen zur Anwendung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, also 23 Jahre nach dem Inkrafttreten der Freizügigkeit in der Schweiz, wurde die heutige Klausel noch nie angewendet.
Welche Veränderungen erwarten die KMU in den Bereichen Strom und Lebensmittelsicherheit?
Tobler: Das Stromabkommen wird den Markt für den Wettbewerb öffnen, wodurch viele KMU den Stromanbieter wählen können, der am besten zu ihnen passt. Darüber hinaus wird die Versorgungssicherheit gestärkt. Das Abkommen über Lebensmittelsicherheit wird bewirken, dass die Schweiz einem gemeinsamen Lebensmittelsicherheitsraum angehört. Die Schweizer Produzenten und Unternehmen werden so unter anderem von klareren gemeinsamen Normen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel profitieren. Damit soll der Handel zwischen den beiden Märkten flüssiger laufen.
Wird die Schweiz die EU-Gesetze automatisch übernehmen müssen?
Tobler: Nein, die Bilateralen III sehen eine sogenannte "dynamische" Rechtsübernahme vor. Dieser Mechanismus betrifft aber nur diejenigen Abkommen, welche die Teilnahme der Schweiz am europäischen Binnenmarkt regeln. In den derzeit gültigen Abkommen ist das in zwei nicht-wirtschaftlichen Abkommen vorgesehen: Im Dublin-Abkommen, wo die Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Asylverfahren geregelt werden, und im Schengen-Abkommen, in dem es um die Zusammenarbeit im Bereich der Grenzkontrollen geht. Mit den Bilateralen III kommen einige weitere Bereiche hinzu: die Personenfreizügigkeit, der Luftverkehr, der Landverkehr und die technischen Handelshemmnisse. Es gibt aber keinen Automatismus.
Wenn sich in der EU eine Regelung ändert, muss sich der betreffende Gemischte Ausschuss mit der Übertragung der Änderung in das Abkommen beschäftigen. Die Schweiz kann sich weigern, diese Änderungen in das Abkommen zu übernehmen, allerdings muss sie dann möglicherweise mit Ausgleichsmassnahmen rechnen. Die Schweiz kann sich jedoch an den Vorarbeiten zum EU-Recht beteiligen, was als "decision shaping" bezeichnet wird. Dies ermöglicht ihr, den Inhalt der Texte im Vorfeld zu beeinflussen, auch wenn sie nicht an der Schlussabstimmung teilnehmen kann. Dank der Beteiligung an den Entscheidungsprozessen hat die Schweiz bereits Ausnahmeregelungen erwirkt, z. B. zum Waffentragen im Schengen-Abkommen, wobei sie das Recht von Wehrpflichtigen geltend machte, ihre Waffe zu Hause aufzubewahren.
Wie könnte die Schweiz bei einem Abbruch oder der Ablehnung der Bilateralen III ihre Beziehungen zur EU angehen?
Tobler: Die Bilateral I und II würden gültig bleiben, doch diese Abkommen würden nach und nach an Relevanz verlieren. Die EU würde ihr Recht weiterentwickeln, ohne dass eine Übernahme in die bilateralen Abkommen garantiert wäre, wodurch eine zunehmende Asymmetrie zwischen dem bilateralen Recht und dem EU-Recht entstünde, was am Ende den Zugang der Schweizer Unternehmen zum europäischen Binnenmarkt beeinträchtigen würde. Wenn die beiden Seiten erneut daran scheitern, sich zu einigen, scheint es mir wenig wahrscheinlich, dass Brüssel einen dritten Verhandlungszyklus akzeptieren würde.