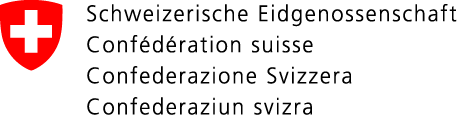Der Unternehmer muss den Preis kalkulieren, den die Kundschaft für seine Produkte zu zahlen bereit ist. Und er muss die Herstellungskosten decken.
Die Preiskalkulation ist die Suche nach dem Gleichgewicht zwischen mehreren Elementen, nämlich dem Aufwand für die Herstellung des Produkts, der angestrebten Marge und der Marktsituation (Angebot und Nachfrage). Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
- Der Kostenpreis. Das ist der Preis, den ein Produkt kosten muss, damit seine Herstellungskosten gedeckt sind. Dazu gehören die effektiven Kosten, die Gemeinkosten ("Overheadkosten"), die Aufwendungen für Administration (Sekretariat, Empfang), Energie (Wasser, Strom), Miete, Telefon, Versicherungen, Bürobedarf, Fahrzeuge, Werbung, Instandhaltung der Geräte, Steuerberater, Buchhaltung usw.
- Der Marktpreis. Der Marktpreis bezeichnet den Preis, den die Kundschaft zu zahlen bereit ist. Hier spielt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage eine entscheidende Rolle: Gibt es von einem Produkt oder einer Dienstleistung nur ein begrenztes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage, lässt sich ein weit höherer Preis erzielen als etwa bei Massenware und/oder wenig gefragten Gütern.
Im Idealfall findet sich ein Mittelwert zwischen dem Kostenpreis und dem Marktpreis, der möglichst nahe an Letzterem liegt. Wenn dies zum Beispiel wegen zu hoher Unternehmenskosten nicht möglich ist, kann eine der folgenden Anpassungen vorgenommen werden:
- ein anderes Zielpublikum anvisieren
- die Kosten senken
- mehr Werbemittel einsetzen, um die Zielgruppe zu vergrössern und Skalenvorteile zu erzielen
- das Angebot so verbessern, dass sich höhere Preise durchsetzen lassen
Oftmals wird die Preispolitik zu einem Teil der Unternehmensidentität. Billigpreise gehören zum Image der Supermarktkette Aldi, während hohe Preise das Bild von Luxusmarken wie Chanel oder BMW prägen. In jedem Segment muss der Preis vom Kunden jedoch als "stimmig" empfunden werden.
Traditionell wird der Preis anhand eines buchhalterischen Ansatzes festgelegt, bei dem zu den Selbstkosten eine gewünschte Marge hinzugerechnet wird. Heute gewinnt jedoch ein marketingorientierter Ansatz an Bedeutung, der sich auf den wahrgenommenen Wert durch die Kundschaft konzentriert:
- "Cost to design": Bei dieser Methode wird der Preis festgelegt, indem die Herstellungskosten mit einem vorab definierten Koeffizienten multipliziert werden, der vom Marktpositionierung des Produkts abhängt. Der Preis richtet sich dabei ausschliesslich nach den Kosten und der angestrebten Gewinnspanne. Ein Gastronom, der einen Faktor 3 anwendet, würde z. B. eine für 9 Franken gekaufte Flasche für 27 Franken verkaufen. Diese Methode ist jedoch für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen ungeeignet, da sie zu hohen, schwer verkaufbaren Preisen führen kann;
- "Design to cost": Diese Methode zielt darauf ab, die Kosten bereits in der Entwicklungsphase eines Produkts zu optimieren. Das Unternehmen definiert einen akzeptablen Zielpreis und zieht davon die gewünschte Gewinnspanne ab, um auf die zulässigen Kosten zu kommen. Dieser Ansatz macht die Kosten zu einer vom Preis abhängigen Variablen, was eine proaktive Preisgestaltung ermöglicht, die sich am wahrgenommenen Kundennutzen orientiert.
Durch die Anwendung der „Design-to-cost“-Methode können Unternehmen wettbewerbsfähigere Preise festlegen, die besser den Erwartungen der Kundschaft entsprechen. Dies kann dazu führen, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung vom Markt besser aufgenommen wird.
Um den Preis zu bestimmen, der von der Kundschaft als fair wahrgenommen wird, kann ein repräsentatives Sample potenzieller Kunden befragt werden - mit zwei zentralen Fragen:
- Welcher ist der maximale Preis, oberhalb dessen sie das Produkt oder die Dienstleistung nicht kaufen würden;
- Welcher ist der minimale Preis, unterhalb dessen sie ebenfalls nicht kaufen würden? Denn der Mindestpreis ist entscheidend: Wird ein Produkt oder eine Dienstleistung zu billig angeboten, kann es aus Sicht der Kundschaft an Glaubwürdigkeit verlieren. Durch die direkte Befragung der Zielgruppe kann das Unternehmen einen Preis festlegen, der sowohl akzeptabel als auch im Einklang mit der Qualität des Produkts oder der Dienstleistung steht.
Preisoptik
Die optische Gestaltung der Preise kann für den Kauf entscheidend sein. Ein Produkt lässt sich für CHF 499 besser verkaufen als für CHF 500. Und bei Schuhen es ist geschickter, 50% Rabatt auf den Kauf des zweiten Paars als 25% beim Kauf von zwei Paaren zu versprechen. Auch kann es wirksamer sein, Rabatte in absoluten Zahlen statt in Prozenten auszudrücken.