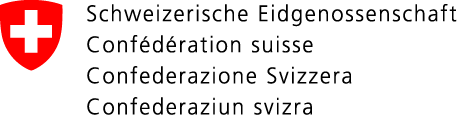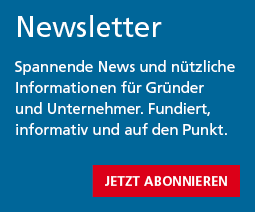(05.02.2025) Eine Studie der ETHZ und der ZHAW hat die Resilienz des Schweizer Energieversorgungssystems untersucht. Wenn die Stromimporte um 70% einbrächen, könnte das Land seinen Bedarf ein Jahr lang ohne besondere Massnahmen decken.
Die Fachleute stützten sich dabei auf ein Modell, nach dem 55% des Bedarfs an Elektrizität durch Wind- und Solarenergie gedeckt würde und die übrigen 45% durch Wasserkraft und günstigen Importstrom unter Einhaltung der Klimaziele. Dieses System wurde anschliessend mit verschiedenen Szenarien konfrontiert, um seine Resilienz für den Fall eines drastischen Rückgangs der Gas- und Stromimporte zu testen. Laut den Ergebnissen der Studie könnte die Schweiz einem Einbruch der Stromimporte um 70% für die Dauer eines Jahres ohne weitere Massnahmen standhalten.
Bei noch stärkeren Rückgängen (um 90 oder 100%) wären die wirtschaftlich tragfähigsten Krisenlösungen Reservekraftwerke, die mit Gas oder Flüssigbrennstoffen betrieben werden. Die Kosten für den Bau dieser Anlagen für fossile Energieträger wären moderat. Ihr Betrieb würde jedoch viel kosten, da Systeme für die Speicherung der CO2-Emissionen installiert werden müssten, um das für 2050 angestrebte Netto-Null-Ziel aufrechtzuerhalten.
Gemäss den Modellierungen der Studie würde der Bau neuer Kernkraftwerke nur in einem extremen Szenario rentabel werden: bei einem vollständigen Ausfall der Importe alle zwei Jahre und ohne verfügbares Gas. Was grünen Wasserstoff angeht, so würde sein Beitrag maximal 2,5 TWh betragen, was 3% der inländischen Nachfrage entspricht.
Die Stauseen sind mit ihrer Speicherkapazität von 9 TWh eine tragende Säule der Schweizer Energiesicherheit. Die Studie hebt auch die entscheidende Rolle von Gas hervor. Wenn Gasimporte in Krisenzeiten möglich bleiben, wird dieser Brennstoff trotz der Kosten für das Herausfiltern der CO2-Emissionen zur bevorzugten Lösung.
Letzte Änderung 05.02.2025