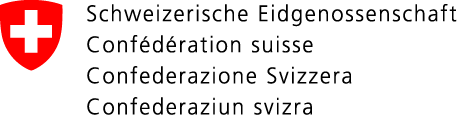Flexibilität wird von den Angestellten eingefordert und für Unternehmen zu einem Schlüsselargument für die Anwerbung und Bindung von Talenten. Doch wie erreicht man mehr Spielraum, ohne dafür Leistung zu opfern? Antworten geben Stefan Planzer, Gründer der Zürcher Agentur Addvanto, und Gudela Grote, Professorin für Organisationspsychologie an der ETH Zürich – mit konkreten Einblicken aus Praxis und Forschung.

"In einem Umfeld, das so hart umkämpft ist wie das digitale Marketing, hat uns die Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt ermöglicht, uns auf dem Arbeitsmarkt von der Konkurrenz abzuheben und hochkarätige Fachkräfte für uns zu gewinnen", erklärt Stefan Planzer, Gründer der Zürcher Agentur Addvanto. "Intern wollen wir die Loyalität der Beschäftigten verbessern, die während der flexibleren Pandemiezeit verzeichneten Effizienzsteigerungen zu Geld machen und eine positive Mundpropaganda fördern."
Ähnlich wie Addvanto überdenken immer mehr Schweizer KMU ihre Arbeitsorganisation und entscheiden sich für flexiblere Modelle. Flexiblere Arbeitszeiten, Vier-Tage-Woche, mehr Homeoffice oder hybride Modelle, variable Vergütung in Form von Gewinnbeteiligung oder die Förderung der internen Mobilität: Es gibt zahlreiche verschiedene Hebel für mehr Flexibilität. Doch ihre Umsetzung wirft viele Fragen auf, darunter die Sinnsuche bei den Beschäftigten, Leistungserfordernisse und der nötige interne Zusammenhalt. Fünf Tipps, damit ein solcher Wandel zum Erfolg wird.
1. Solide Grundlagen sicherstellen
Mehr Flexibilität im eigenen Unternehmen einzuführen, ist kein Kinderspiel. "Das Unternehmen muss aus wirtschaftlicher und organisatorischer Sicht gesund und stabil aufgestellt sein", erläutert Stefan Planzer. Auch die Firmenkultur muss für diesen Wandel geeignet sein. "Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, einen offenen Austausch zwischen allen Mitgliedern der Organisation zu schaffen", ergänzt Gudela Grote, Professorin für Organisationspsychologie an der ETH Zürich. Ein Mangel an finanziellen Spielräumen, eine fragile Organisation oder eine Firmenkultur, die wenig Offenheit für Veränderungen aufweist, können die Einführung flexibler Modelle beeinträchtigen. "Man muss zu einem Konsens gelangen, der die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter, der Teams und des Unternehmens als Ganzes berücksichtigt."
2. Ein passendes Modell wählen
Flexibilität als solche ist ... flexibel und mit ein und demselben Modell können verschiedene Realitäten abgedeckt werden. Ein Unternehmen, das die 4-Tage-Woche einführen will, muss festlegen, ob dabei 40 Arbeitsstunden auf vier Tage verteilt werden sollen, ob es um 80% Arbeitszeit bei 100% Lohn geht oder ob es sich um ein Teilzeitmodell handeln soll. Jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile. "Wenn das Unternehmen auf Stundenlöhnen basiert, wird es vielleicht nicht die beste Lösung sein, die Anzahl der Arbeitsstunden zu reduzieren", meint Stefan Planzer. "Das gewählte Modell muss immer der Effizienz dienen." Dieser Ansicht ist auch Gudela Grote: "Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten kann sich für KMU schwieriger gestalten, da diese häufig weniger Spielräume haben, um die Arbeit an den Zeitplan jedes einzelnen Mitarbeiters anzupassen. Aber in der Regel können alle Modelle an die Arbeitsweise der KMU angepasst werden."
3. Teams einbeziehen
"Wir haben uns für eine Vier-Tage-Woche bei vollem Gehalt entschieden – das Team hat die Umstellung offen angenommen", erklärt Stefan Planzer. Die konkrete Umsetzung der Modalitäten kann sich jedoch mitunter als komplex erweisen. "Flexibles Arbeiten soll den Beschäftigten die Möglichkeit geben, ihre Arbeitszeiten und ihren Arbeitsort an ihren Rhythmus und ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn diese Flexibilität allerdings dazu führt, dass von den Mitarbeitenden verlangt wird, sich jederzeit verfügbar zu halten, kann sie restriktiv werden", warnt Gudela Grote. Man sollte sich also vergewissern, dass alle, die an der Einführung eines neuen Modells beteiligt sind, auf derselben Wellenlänge sind.
4. Regeln festlegen
Die Einbindung der Teams reicht nicht aus, wenn es keinen strukturierenden Rahmen gibt. "Flexibilität kann kontraproduktiv werden, wenn es zu viele Wahlmöglichkeiten gibt, vor allem, wenn diese nicht koordiniert werden", weiss Gudela Grote. Auf diese Hürde ist auch Stefan Planzer gestossen: "Am Anfang, also im Jahr 2022, hatten wir den Teams bei der Gestaltung ihrer Zeitpläne maximale Freiheit eingeräumt. Doch das führte schnell zu einer Überlastung in Bezug auf interne Kommunikation und Koordination." Als die Grenzen dieses Ansatzes deutlich wurden, entschied sich der Unternehmer für eine Überarbeitung der Regelung: "Nach einer zweimonatigen Testphase haben wir das Modell mit Regeln angepasst, die von den Teams selbst vorgeschlagen wurden." Diese Massnahmen umfassen gemeinsame Präsenztage, Kernzeiten, geteilte Kalender und wechselnde Bereitschaftsdienste.
5. Ergebnisse messen und Anpassungen vornehmen
Die Einführung eines flexiblen Arbeitsmodells erfordert auch, dass man anhand von einfachen und konkreten Indikatoren regelmässig sicherstellt, dass es funktioniert. "Man muss die Effizienz der gewählten Option bewerten: Werden die Projekte pünktlich fertiggestellt? Wird das Budget eingehalten? Sind die Mitarbeitenden zufrieden? Nimmt der Absentismus ab?", führt Gudela Grote weiter aus. Bei Addvanto hat das Team gelernt, das Modell in Abhängigkeit von den erzielten Ergebnissen anzupassen. "Wir mussten unsere Praxis immer wieder optimieren, um den Kunden nicht aus dem Blick zu verlieren", erzählt Stefan Planzer. Das Unternehmen muss bereit sein, schnell zu reagieren und sich anders auszurichten. Die Lösung? Ein pragmatisches zyklisches Vorgehen, bei dem auf jedes Experiment eine kollektive Feedback-Runde und konkrete Anpassungen folgen.
Zum Thema
Zwischenmenschliche Kontakte nicht vernachlässigen
Selbst wenn sich ein Unternehmen für ein hybrides Modell oder Homeoffice entscheidet, bleiben zwischenmenschliche Kontakte entscheidend. "Die Kommunikation in Präsenz kann nicht vollständig ersetzt werden", erklärt Gudela Grote, Professorin für Organisationspsychologie an der ETH Zürich. "Der informelle Austausch spielt für den Zusammenhalt im Team eine Schlüsselrolle. Es geht also darum, die richtige Balance zwischen Präsenz und physischer Distanz zu finden, damit der soziale Kontakt aufrechterhalten wird und so die Zusammenarbeit im Team gut funktioniert."
Im Gespräch
Letzte Änderung 02.07.2025