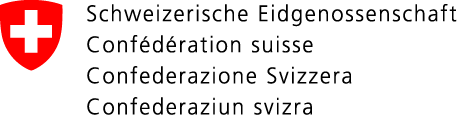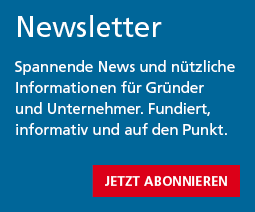Unter dem Einfluss des Klimawandels werden extreme Wetterereignisse häufiger und intensiver. Die dadurch verursachten Schäden stellen KMU und Versicherer vor neue Herausforderungen, wie Annemarie Büttner, Lead Climate Risk Solutions bei Swiss Re, erklärt.
2024 machten die Überschwemmungen im Rhônetal und im Maggiatal, die ersten Schätzungen zufolge Kosten von CHF 200 Millionen verursachten, wieder einmal deutlich, dass auch die Schweiz von Naturkatastrophen betroffen ist. Laut den Szenarien des Weltklimarats IPCC werden Extremwetterphänomene wie Hitzewellen und Gewitterstürme immer häufiger und bewirken immer schwerere und teurere Schäden. Wie kann man sich an diese Bedrohungen anpassen? Und wie sichert man sich am besten ab? Antworten von Annemarie Büttner, die bei Swiss Re Corporate Solutions, dem Industrieversicherungsarm der Swiss Re Gruppe, für Lösungen im Umgang mit Klimarisiken zuständig ist.
In welchem Ausmass haben die Ausgaben im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in den letzten Jahren zugenommen?
Annemarie Büttner: Weltweit haben wir seit Mitte der 2010er Jahre einen Aufwärtstrend bei den durch Naturkatastrophen bedingten Verlusten in Höhe von 5% bis 7% pro Jahr festgestellt. In unserem Land erwärmt sich das Klima doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt und ist schon bei plus 2,6°C im Vergleich zum vorindustriellen Klima gestiegen. Die Schweiz gehört zu den zehn Ländern, die europaweit am stärksten durch Naturgefahren wie Überschwemmungen, Winterstürme oder heftige Gewitter gefährdet sind.
Darüber hinaus beobachten wir eine Verschlimmerung der Hitzewellen, Dürren und Waldbrände mit sehr konkreten Folgen für die Sicherheit von Sachwerten. Zum Beispiel führten die intensiven Regenfälle des Sturms "Bernd" (Anm. d. Red.: der insbesondere in Zürich erhebliche materielle Schäden verursachte) zu Sturzfluten, und mehrere Flüsse und Seen erreichten kritische Stände, auch in der Stadt.
Wie passen sich die Versicherungsmodelle an diese Entwicklung an?
Büttner: Heute basiert die Modellierung von Naturkatastrophen und ihren Folgen nicht mehr allein auf historischen Daten. Wir haben eine Plattform – Risk Data and Services (RDS) – entwickelt, auf der die Unternehmen die Koordinaten ihrer Standorte eingeben können, um eine Bewertung der aktuellen und künftigen Risiken auf Basis der wissenschaftlichen Daten des IPCC zu erhalten. Mit Hilfe dieser Analyse können anhand verschiedener Klimaszenarien die Verluste zahlenmässig eingeschätzt werden die unter den klimatischen Bedigungen von 2030 oder 2050 erwartet werden können.
Bereiten sich die Unternehmen ausreichend auf diese Veränderungen vor?
Büttner: Wir ermutigen die Unternehmen, beim Thema Naturgefahren proaktiv vorzugehen. Viele haben diesen Weg schon eingeschlagen, indem sie die erforderlichen Massnahmen für die Verbesserung ihrer Resilienz gegenüber Naturgefahren treffen. Dies kann über einen Risikotransfer (traditionelle Versicherung) erfolgen oder über einen verstärkten physischen Schutz, indem man zum Beispiel die Waren erhöht lagert, um sie vor Überschwemmungen zu schützen.
Langfristig werden sich die Versicherungsprämien der erhöhten Intensität und Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen getrieben durch den Klimawandel anpassen, also in vielen Gebieten steigen. Wichtig ist es für Firmen regelmässig zu überprüfen, ob die Selbstbeteiligung und die Deckungslimiten ihren Bedürfnissen und ihren finanziellen Kapazitäten entsprechen. Verlängerte Laufzeiten von Policen sind auch eine Möglichkeit sich feste Prämien zu sichern.
Werden Unternehmen mit höheren Prämien belastet, obwohl sie Schutzmassnahmen ergreifen?
Büttner: Sofern ein Kunde nachweisen kann, dass Schutzmassnahmen zur Reduzierung oder Verhinderung von Schäden durch Naturgefahren errichtet wurden, so fliessen diese Informationen in unsere Modelle ein, d.h. die Prämie sollte dadurch entlastet werden. Dies wirkt dem erwarteten Anstieg durch Intensivierung der Naturkatastrophen durch den Klimawandel entgegen. Eine Schutzmassnahme könnte zum Beispiel die Errichtung einer permanenten Flutbarriere sein, welche das Gebäude von Hochwasser schützt.
Welche Rolle spielen staatliche Massnahmen im Risikomanagement?
Büttner: Bund und Kantone investieren viel Geld in bauliche Errichtungen zur Reduzierung von Schäden durch Naturgefahren. Als Beispiel dienen hier die Hochwasserschutzmassnahmen im Reusstal (Kanton Uri) oder auch im Rohnetal im Wallis. Dort hat sich das Risiko für Schäden durch Überschwemmung wegen den Verbauungen in den letzten 20 Jahren merklich reduziert. Das gleiche gilt für Lawinenverbauungen oder Schutzmassnahmen gegen Steinschlag etc. Die Gefahrenkarten werden ausserdem bei baulichen Veränderungen durch die Kantone regelmässig angepasst und spiegeln sich in unseren Naturgefahrenmodellen wieder.
Welche praktischen Tipps würden Sie Unternehmen für die Reduzierung der Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen geben?
Büttner: Beginnen sollte man mit einer Bewertung sämtlicher Naturgefahren, denen das Unternehmen heute und in Zukunft ausgesetzt ist. Dafür kann man zum Beispiel die von den kantonalen Behörden erstellten Gefahrenkarten oder die Swiss Re RDS-Plattform nutzen. Anschliessend sollte man einen Plan zur Risikominderung erarbeiten. Dieser Schritt besteht darin, darauf spezialisierte Risikoingenieure damit zu beauftragen, die Sicherheit der Standorte zu bewerten und verbessern. Die Lösungen umfassen beispielsweise die Errichtung von Hochwasserschutzwänden, die regelmässige Reinigung der Abwasserleitungen oder auch die Vorbereitung von Sandsäcken. Häufig sind es einfache Massnahmen, die im Falle eines Extremwetterereignisses der ausschlaggebende Faktor sein können.