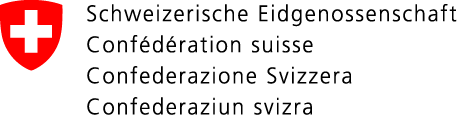Der Bausektor sucht nach konkreten Lösungen, um seinen CO2-Fussabdruck zu verringern, besonders in der Produktion von Beton und Stahl. Christian Paglia, Experte für Baumaterialien, stellt erhebliche Fortschritte fest, auch wenn mehrere technische Normen noch angepasst werden müssen.
Die Fertigung von Baumaterialien macht in der Schweiz rund 10% der Treibhausgasemissionen aus, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilt. Dieser hohe Anteil ist vor allem auf die Produktion von Zement und Stahl zurückzuführen. Um den Übergang zu einem CO2-armen Modell einzuleiten, stellt sich die Baubranche (auf die 2021 knapp CHF 35 Milliarden und damit 5% des BIP entfielen) neu auf und nutzt neue, weniger energieintensive Materialien und Verfahren wie zum Beispiel LC3-Beton. Die Experten setzen auch auf die Wiederverwendung von Bauteilen und auf die Planung des Lebensendes von Gebäuden, wie Christian Paglia erklärt, der an der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) das Institut für Materialien und Bau leitet.
Mit welchen technischen Lösungen lassen sich heute die CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung von Beton reduzieren?
Christian Paglia: Man muss sich auf Lösungen konzentrieren, die es ermöglichen, den Portland-Zement (traditioneller Zement mit hohem Klinkeranteil, bei dessen Herstellung grosse Mengen an CO2 freigesetzt werden, Anm.d.Red.) teilweise durch emissionsärmere Varianten zu ersetzen. Eines der aktuell vielversprechendsten Rezepte ist heute wohl der LC3-Zement, der einen hohen Anteil an kalziniertem Ton und Kalk enthält. Das Aargauer Unternehmen JURA hat einen Zement vom Typ LC3 entwickelt, der zu 100% aus der Schweiz stammt. Wissenschaftler erforschen noch weitere Ansätze, wie die Beimischung von landwirtschaftlichen Abfällen (Asche aus Reisspelzen, Einstreu aus Holz) und von sauberen Verbrennungsabfällen mit niedrigem Schwermetallgehalt in den Zement. Die vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein aufgestellten Normen ermöglichen mittlerweile die Zulassung von alternativem Zement, vorausgesetzt, dieser weist dieselben mechanischen Eigenschaften auf wie traditioneller Beton. So werden beispielsweise in den Zement vom Typ CEM VI recycelte Materialien von abgerissenen Gebäuden beigemischt.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Verringerung der Transportwege durch die Verwendung lokaler Baustoffe. Dieser Ansatz begünstigt unter anderem die Entwicklung von lokalen Industrien für Herstellung und Recycling, die den Bausektor weniger abhängig von Importen machen.
Stahl ist ebenfalls eine erhebliche Quelle für CO2-Emissionen. Wie kann man ihn umweltfreundlicher machen?
Paglia: Eines der wirksamsten Verfahren ist das Recycling von Stahl. Bei gleichem Volumen stösst das Recycling von Stahl auf der Basis von Altmetall 50% weniger CO2 aus als die Produktion auf der Basis von Erz. Heute stammt der gesamte in der Schweiz produzierte Stahl aus diesem Recycling-Verfahren, bei dem Elektrolichtbogenöfen anstelle der deutlich umweltschädlicheren Kohleöfen eingesetzt werden. Um den CO2-Fussabdruck noch weiter zu verkleinern, muss man zudem die direkte Wiederverwendung von Bauteilen aus Stahl fördern, bei der kein Recycling erforderlich ist. Diese Praxis gibt es bereits, aber ihr Einsatz im grossen Massstab scheitert an zwei Hürden: Es gibt keine klaren Normen für die Wiederverwendung und es ist erforderlichen, den Erhaltungszustand der Elemente am Ende ihres Lebenszyklus zu evaluieren.
Auch die architektonische Planung ist ein wichtiger Aspekt bei der Reduzierung des CO2-Abdrucks der Branche. Welche Herausforderungen bestehen auf diesem Gebiet?
Paglia: Die Baufirmen und die Eigentümer beginnen damit, das Lebensende des Gebäudes im Hinblick auf die Wiederverwertung der Materialien besser zu berücksichtigen. Es gibt Lösungen, mit denen sich das Wiederverwertungspotenzial steigern lässt, insbesondere durch die Förderung der Vereinheitlichung und der Vorfertigung der Bauteile. Es fehlen jedoch in der Branche klare Leitlinien, um die vorgefertigten Bauteile und die Montage zu verbessern.
Welche Geschäftsgelegenheiten ergeben sich für die Unternehmen durch die Dekarbonisierung?
Paglia: Eine Veränderung in der Materialtechnologie kann als grosse Chance für die Aufwertung der lokalen Ressourcen angesehen werden. Diesbezüglich kann man zum Beispiel der Verwendung von Holzasche aus der Region Priorität einräumen, um importierte Stoffe zu ersetzen. Eine weitere Lösung besteht darin, schlammige Zementmaterialien aus den Betonmischmaschinen wiederzuverwenden. Anstatt sie auf die Deponie zu bringen, könnte man diese Reststoffe in die Betonproduktion integrieren, um den Anteil an Portland-Zement zu reduzieren, bei dem die CO2-Emissionen besonders hoch sind. Am SUPSI bereiten wir derzeit Projekte vor, die in diese Richtung gehen, in Zusammenarbeit mit einem in der Region ansässigen Betonproduzenten.
Innovative Projekte haben es ermöglicht, Wohngebäude mit niedrigen CO2-Emissionen zu bauen und daraus Kohlenstoffsenken zu machen, indem unter anderem Hanfbeton verwendet wird. Sind diese Lösungen zukunftsweisend?
Paglia: Die Verwendung von Hanfbeton ist interessant für die thermische und akustische Dämmung. Im Hinblick auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks bietet Hanfbeton einige Vorteile, er lässt sich aber weniger leicht wiederverwerten, da er nicht genau dieselben mechanischen Eigenschaften aufweist. Ausserdem muss man sicherstellen, dass der Hanf aus nachhaltigem Anbau stammt.