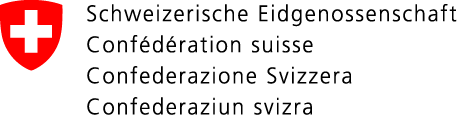Die Arbeitgeber müssen sich an eine veränderte Lebensweise der Beschäftigten und an den Boom von Homeoffice im Ausland anpassen. Die damit verbundenen rechtlichen und administrativen Risiken stellen jedoch häufig eine Hürde für die Umsetzung dar. Antworten von Isabelle Wildhaber, Expertin für Wirtschaftsrecht und Digitales Recht.
Obwohl das Arbeiten in Präsenz in der Schweiz wieder der Standard geworden ist, nimmt das Phänomen der Telearbeit aus dem Ausland seit der Pandemie weiter zu. So erlaubt beispielsweise das KMU Redguard seinen 80 Beschäftigten, einmal pro Jahr für vier bis sechs Wochen von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Für Firmengründer Sven Vetsch bietet das die Chance, seine Leidenschaft für das Reisen und seinen Wunsch, sich für ein stark wachsendes Unternehmen zu engagieren, miteinander zu vereinbaren. Grosse Firmen wie der Versicherer AXA haben ebenfalls beschlossen, diese Arbeitsweise offiziell zu verankern und einen Rahmen dafür zu schaffen.
Dieser neue Trend ist für Unternehmen gleichermassen eine Chance und eine Herausforderung. Einerseits kann das Angebot, dass die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit eine Zeitlang aus dem Ausland ausüben dürfen, ein wertvoller Pluspunkt sein, um die besten Kräfte für sich zu gewinnen, besonders in Branchen mit Fachkräftemangel. Andererseits erfordert die Einführung dieser Option von den Arbeitgebern die Regelung zahlreicher Fragen in Verbindung mit steuerlichen Verpflichtungen, Sozialversicherungen und dem Migrationsstatus, die ein Hindernis darstellen können. Isabelle Wildhaber, Professorin für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen und Gründerin des Start-ups Vamoz, einer Plattform mit "Software as a Service", welche die Arbeit im Ausland erleichtert, klärt auf, welche Herausforderungen diese Praxis für die Unternehmen mit sich bringt.
Warum sollte ein Arbeitgeber seinen Angestellten Homeoffice aus dem Ausland erlauben?
Isabelle Wildhaber: Es gibt in der Schweiz eine wachsende Nachfrage nach Arbeiten aus dem Ausland, selbst bei Unternehmen, die ihren Beschäftigten diese Möglichkeit nicht offiziell anbieten. Die Arbeitgeber können diesen Trend nur schwer ignorieren, vor allem wenn ihre Branche vom Fachkräftemangel betroffen ist. Firmen im IT-Sektor beschäftigen zum Beispiel relativ wenig vorhandene Fachkräfte, die jederzeit problemlos den Arbeitgeber wechseln könnten. Ihnen Arbeiten aus dem Ausland anzubieten, gehört zu den wirksamsten Mitteln, um Talente anzuwerben und zu halten.
Welche Gründe bringen die Beschäftigten hauptsächlich dazu, nach einer solchen Möglichkeit zu fragen?
Wildhaber: Immer häufiger wird die Gelegenheit genutzt, um einen Auslandsaufenthalt nach dem Urlaub zu verlängern (man spricht dann von "Workation", aus "work" und "vacation") oder einfach, um den Winter in einer Region mit tropischem Klima zu verbringen. Einige Länder im Süden haben das auch schon erkannt und versuchen, davon zu profitieren, indem sie für "digitale Nomaden" einen eigenen Migrationsstatus anbieten. Allerdings spiegelt die Fantasie des digitalen Nomaden, der in Shorts am Badestrand arbeitet, nicht die Mehrzahl der Fälle wider. Wir stellen fest, dass die meisten Wünsche, die an die Arbeitgeber herangetragen werden, mit der persönlichen und familiären Situation der Beschäftigten zu tun haben. Viele von ihnen haben Familie im Ausland und möchten diese geographische Flexibilität nutzen, um sich beispielsweise um ihre alten Eltern zu kümmern oder während der Schulferien näher bei der Familie zu sein.
Einige Unternehmen wollen sich dazu lieber nicht positionieren oder sie verbieten diese Praxis, um vor möglichen administrativen und rechtlichen Risiken geschützt zu sein. Ist das eine vernünftige Entscheidung?
Wildhaber: Arbeitgeber können dieser neuen Frage nicht gleichgültig gegenüberstehen und die Entscheidung für ein schlichtes Verbot birgt Risiken. Es schadet der Attraktivität der Firma auf dem Arbeitsmarkt und hält die Mitarbeitenden nicht davon ab, heimlich aus dem Ausland zu arbeiten. Denn selbst wenn ein Unternehmen nicht weiss, dass sich sein Mitarbeiter im Ausland befindet, kann es für dessen widerrechtliche Situation haften und gebüsst werden, wenn die Behörden es herausfinden.
Auf welche Weise lässt sich Arbeiten aus dem Ausland am besten regeln?
Wildhaber: Die Herausforderung besteht darin, die richtige Balance zwischen Flexibilität und Stabilität zu finden. Es gibt für dieses Thema heute Beratungsdienstleister und automatisierte Plattformen (wie z.B. unsere Plattform Vamoz), welche die Risiken, die mit der jeweiligen Anfrage verbunden sind, von Fall zu Fall bewerten und die Beschäftigten bei den einzelnen Schritten begleiten.
Es ist auch möglich, sich anstelle einer Einzelfallprüfung für eine Pauschallösung zu entscheiden, indem man zum Beispiel pro Jahr 20 Tage Telearbeit in der Europäischen Union (EU) oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) gestattet. Doch selbst bei einem kurzzeitigen Arbeitsaufenthalt innerhalb der EU können gewisse Risiken in Verbindung mit dem Migrationsstatus oder den Versicherungen nicht ausgeschlossen werden. Deshalb ist eine Einzelfallprüfung vorzuziehen.
In vielen Berufen steht dieser erhebliche Vorteil aus praktischen Gründen nicht zur Verfügung. Wie können die Arbeitgeber mit dieser Ungleichheit umgehen?
Wildhaber: Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass man ein System mit zwei Klassen schafft. Besonders in der Industrie ist Telearbeit für viele unmöglich. Doch anstatt den Beschäftigten, die es können, die Telearbeit aus dem Ausland zu verbieten, sollte man lieber denjenigen, die es nicht können, andere Vorteile anbieten.
Informationen
Zur Person/Firma

Die Juristin Isabelle Wildhaber hat ihre Abschlüsse an den Universitäten Basel, Harvard und Zürich erworben und ist seit 2010 Professorin für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen. Dort hat sie unter anderem das Law & Tech Lab mitaufgebaut, eine interdisziplinäre Forschungsgruppe im Bereich des Digitalen Rechts. Zudem gründete sie 2022 das Start-up Vamoz, das juristische und praktische Beratung für Unternehmen anbietet, welche Telearbeit aus dem Ausland bei sich einführen wollen.
Letzte Änderung 15.05.2024