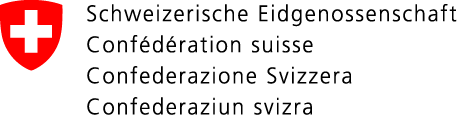Die Hälfte der KMU in der Schweiz hat eine Überlebensdauer von höchstens fünf Jahren. Um ihre Erfolgschancen zu erhöhen, gehen Unternehmerinnen und Unternehmer das Thema Scheitern proaktiv an und beschäftigen sich schon in der Anfangszeit mit der Frage, wie ihr Unternehmen eines Tages sterben könnte.

Jede zweite Schweizer Firma ist fünf Jahre nach ihrer Gründung nicht mehr am Leben. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik für den Zeitraum 2017 bis 2022 hervor. Angesichts dieser hohen Misserfolgsquote lohnt sich ein Blick auf Methoden, mit denen man schon ab der Lancierung eines Unternehmens die Risiken für dessen Untergang antizipieren kann.
Pre-mortem-Methode
2007 entwickelte der amerikanische Psychologie Gary Klein die "Pre-mortem-Methode". Bei dieser Übung fordert der Experte die Unternehmer dazu auf, sich den Tod ihres Projekts in einem Zeitraum zwischen sechs Monaten und einem halben Jahr vorzustellen. Anschliessend hat jeder von ihnen einige Minuten Zeit, um auf einem Zettel alle möglichen Gründe zu notieren, die zu diesem Untergang führen könnten. Danach findet ein Debriefing statt.
Johann Schlieper, Business Angel und Coach mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz in Zürich, kennt diese Methode. "Sie ist interessant, weil sie die Tatsache hervorhebt, dass im Bereich des Unternehmertums Scheitern dazugehört, besonders in disruptiven Branchen wie KI, IKT, MedTech und FinTech. Allgemein heisst es, dass acht von zehn auf den Markt gebrachten Innovationen scheitern. Ich selbst habe in 20 Start-ups investiert und acht davon gibt es heute nicht mehr."
Das richtige Timing
Um sich das Scheitern seiner Firma vorzustellen, sollte man jedoch das richtige Timing wählen. "Bei der Ausarbeitung des Pitchs, in dem man eine Unternehmensidee auf fünf bis zehn Seiten darstellt, müssen sich die Unternehmer zum Beispiel die Frage stellen, was schief gehen könnte, und prüfen, ob das hohe Potenzial der Firma ein Gegengewicht zu den Risiken bildet."
In der zweiten Phase, bei der sogenannten Due Diligence, sollte man laut Johann Schlieper dann externe Experten einbeziehen. "Diese werden sich fragen, ob der Plan realistisch ist, sowohl was die technische Machbarkeit, die Kosten und die finanziellen Erträge angeht, als auch in Bezug auf die Absatzmärkte und die Eignung des Teams."
Abgesehen von diesen beiden Phasen zweifelt der Zürcher Investor daran, ob eine Pre-mortem-Analyse das Richtige ist. "Sobald alles auf den Weg gebracht ist, drückt es auf die Stimmung, wenn man einem enthusiastischen Team sagt ‘und jetzt stellt euch vor, dass alles kaputt geht, und fragt euch, wie es dazu kommen konnte’."
Im eigenen Umfeld darüber sprechen
Für Thomas Dübendorfer, Präsident des grössten Schweizer Business Angel Clubs SICTIC, ist es wichtig, sich das Motto des Silicon Valley ins Gedächtnis zu rufen: "Fail fast and fail cheap". "Man darf es nicht so machen wie diese Gründer, die im stillen Kämmerlein ihre gesamten Ressourcen in die Entwicklung ihres Start-ups stecken und aus Angst vor dem Urteil anderer oder aber, weil sie extrem zuversichtlich sind, jahrelang nicht darüber sprechen und am Ende scheitern." Der Experte rät im Gegenteil dazu, sein Projekt von Anfang an so oft wie möglich im eigenen Umfeld vorzustellen, um alle eigenen Annahmen zu hinterfragen.
Das Produkt auf den Prüfstand stellen
Thomas Dübendorfer, der 2024 von SECA zum Business Angel des Jahres ernannt wurde, war selbst an der Gründung von neun Tech-Start-ups beteiligt und sieht zwei Hauptgründe für den Misserfolg, die man im Blick haben sollte. Der erste ist die fehlende Passung zwischen der vom Unternehmen verkauften Lösung und dem hierfür vorhandenen Markt. "Man muss sein Produkt so früh wie möglich mit einer systematischen Analyse, die sich Product-Market-Fit nennt, auf den Prüfstand stellen. Bietet mein Produkt wirklich eine Lösung für ein Problem? Brauchen die Konsumenten diese Lösung und wenn ja, sind sie bereit, dafür zu zahlen? Ist die Zielgruppe gross genug?" Nach dieser Analyse könnte ein Unternehmen zum Beispiel beschliessen, seinen Dienst eher im B2B-Bereich zu verkaufen als, wie ursprünglich geplant, im B2C-Bereich, da es zu viel Zeit kosten würde, mit einer eigenen Marke das Vertrauen der Endkunden zu gewinnen.
Ein passendes Team wählen
Eine weitere grosse Hürde stellt häufig das Team dar. "Nehmen wir einmal das Beispiel von Gründern aus einem akademischen Umfeld", sagt Thomas Dübendorfer. "Bisher haben sie ihr Start-up vor allem als Forschungsprojekt gesehen. Ihnen muss klar werden, dass es nicht nur um ein Projekt geht, sondern um ein ganzes Unternehmen, das unter anderem wachsen und Gewinn bringen, Risiken eingehen und Personal einstellen und ausländische Märkte erschliessen muss."
Deshalb sollte man sich frühzeitig die Frage stellen, ob das Führungsteam geeignet ist. "Hat es die nötigen Kompetenzen, um alle Aufgaben zu erfüllen? Verfolgen die verschiedenen Gründungsmitglieder dieselben Ziele, sind sie sich beispielsweise einig, ob ihre Firma langsam oder schnell wachsen soll, wollen sie ein KMU mit langer Lebensdauer aufbauen oder es rasch wieder verkaufen? Auch der Coach Johann Schlieper sieht die Frage nach dem Team als unerlässlich an: "Einen erfahrenen Unternehmer an Bord zu haben, der vielleicht selbst schon einmal gescheitert ist, ist für ein Start-up eine Stärke."
Informationen
Zum Tema
Veranstaltungen, die das Tabu des Scheiterns brechen
Es ist nicht leicht, sein Firmenprojekt vor Unbekannten zu präsentieren. Damit Unternehmer lernen, mit dieser Angst umzugehen, und vorankommen, veranstalten mehrere Organisationen der Start-up-Förderung wie Impact Hub Switzerland oder IFJ verschiedene Events, die der Begegnung und dem Austausch dienen. Alles begann vor mehr als zehn Jahren mit den ersten FUN-Abenden (für "Fuck-up Nights") in der Schweiz. Von Genf bis Zürich und von Basel bis Lugano erklären dort Dutzende Firmengründer auf der Bühne, was in ihrer Firma nicht funktioniert hat. Seitdem sind weitere Formate wie beispielsweise Pitch'n'Bar entstanden. Hierbei treten die Gründerinnen und Gründer in gemütlicher Atmosphäre öffentlich auf und stellen dem Publikum kurz und überzeugend ihre Firmenidee vor. Am Ende vergeben die Jury und die Zuschauer eine Note und die eindrücklichsten Pitches erhalten einen Preis.
Im Gespräch
Letzte Änderung 02.04.2025