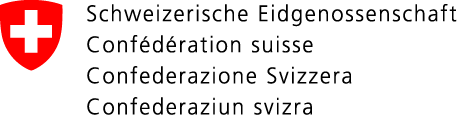Die Schweizer Unternehmen investieren immer mehr in Informatik-Tools, doch die Schulung des Personals hinkt manchmal hinterher, stellt Andrea Belliger, Expertin für Digitalisierung, fest.
Der Vormarsch der künstlichen Intelligenz, die wachsenden Datenmengen und die Automatisierung bewirken eine radikale Veränderung der Arbeitsweise der Unternehmen und bringen neue Berufe hervor. Andrea Belliger, Professorin am Institut für Kommunikation & Führung (IKF) in Luzern, erklärt, welche Strategien die Unternehmen zum Beispiel im Bereich Weiterbildung einführen sollten, um bestmöglich von diesen Entwicklungen zu profitieren.
Was sind die wichtigsten Auswirkungen der Digitalisierung auf den Schweizer Arbeitsmarkt?
Andrea Belliger: Die digitale Revolution hat nicht nur innovative Technologien geschaffen, sondern auch eine Vielzahl neuer Berufsbilder entstehen lassen. Denken Sie an den Digital Experience Designer, der für die Gestaltung guter Nutzererlebnisse bei digitalen Produkten und Dienstleistungen zuständig ist. Diese Rollen sind heute in vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Spannend ist auch die Entstehung von sogenannten "hybriden" Profilen. Wir sehen beispielsweise Pflegefachpersonen, die Data-Literacy-Kompetenzen, also Fähigkeiten zum Verstehen und Arbeiten mit Gesundheitsdaten, besitzen oder Architekten mit Expertise im digitalen Bauen.
Doch die Veränderung geht tiefer: Berufe verschwinden nicht einfach oder werden komplett neu geschaffen, sie transformieren sich. Der klassische Sachbearbeiter entwickelt sich zum Prozessdesigner mit Automatisierungskompetenz und die HR-Fachfrau wird zur Gestalterin kultureller Transformation.
Wo liegen aktuell die Herausforderungen in der Schweiz bei der Ausbildung für diese neuen Berufe?
Belliger: Die grösste Herausforderung sehe ich darin, dass unsere Ausbildungssysteme der rasanten technologischen Entwicklung oft hinterherhinken. Berufsbilder verändern sich schneller, als Lehrpläne angepasst werden können. Zudem gibt es einen Mangel an Dozierenden mit aktueller Praxiserfahrung in Bereichen wie KI, agiler Organisationsentwicklung oder digitaler Ethik. Gerade in Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Bau, der Finanzbranche oder dem produzierenden Gewerbe ist der Bedarf an digital-kompetenten Fachkräften gross – also überall dort, wo Prozesse komplex, stark reguliert und gleichzeitig stark auf den Menschen ausgerichtet sind. Dabei benötigen KMU nicht nur reine IT-Spezialisten, sondern vor allem Mitarbeitende, die Technologie, Kommunikation und Unternehmenskultur wirkungsvoll miteinander verbinden können.
Sollten alle KMU einen "Data Scientist" einstellen?
Belliger: Nicht zwingend. Die entscheidende Frage ist nicht: "Brauche ich einen Data Scientist?", sondern vielmehr: "Wie können wir datenbasiert bessere Entscheidungen treffen?" – etwa bei der Auswahl von Mitarbeitenden durch datenbasierte Kompetenzprofile, im Kundenservice durch die Analyse von Feedback- und Supportdaten oder in der Lagerverwaltung durch vorausschauende Bedarfsplanung und automatisierte Bestellprozesse.
KMU sollten nicht isolierte neue Rollen schaffen, sondern vielmehr Daten- und Technologiekompetenzen in ihre bestehenden Teams integrieren. Fähigkeiten wie Dateninterpretation, kritisches Denken, ethische Reflexion oder die Fähigkeit zur Kooperation mit KI sind heute Schlüsselqualifikationen – und das gilt auch für bereits bestehende Mitarbeitende.
Die Digitalisierung bringt nicht nur neue Berufe mit sich, sondern verändert die Art und Weise wie wir arbeiten. Oft wird dafür der Begriff New Work verwendet. Was bedeutet dieses Konzept eigentlich?
Belliger: New Work ist mehr als flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice. Im Mittelpunkt steht immer stärker die innere Arbeit: Resilienz, Selbstführung und emotionale Kompetenz werden Schlüsselkompetenzen in einer sich ständig verändernden Welt. Auch Führungsmodelle wandeln sich: Statt Top-down setzen Unternehmen auf Servant Leadership – Führung als Unterstützung – und auf geteilte Verantwortung, um Eigeninitiative zu fördern. Zudem bauen Unternehmen Hierarchien ab und setzen auf agile, selbstorganisierte Teams.
Auch Lohnsysteme werden neu gedacht: Modelle wie New Pay stehen für mehr Transparenz und Mitsprache. Ein Beispiel: Ein Schweizer KMU mit 140 Mitarbeitenden hat ein neues Vergütungssystem entwickelt. Mitarbeitende bestimmen mit, indem sie Erfolge gemeinsam bewerten und so faire Löhne gestalten.
KI-Tools verändern die Zusammenarbeit grundlegend. Viele KMU nutzen sie heute schon für Routineaufgaben wie Newsletter schreiben, Kundenfeedback auswerten oder Angebote erstellen. Die Mitarbeitenden behalten die Kontrolle, arbeiten aber mit KI-Assistenten schneller, genauer und kreativer.
Inwiefern können KMU von New Work profitieren?
Belliger: Wenn Unternehmen New Work ernst nehmen, schaffen sie nicht nur attraktivere Jobs, sondern werden auch widerstandsfähiger, lernfreudiger und zukunftsfähiger.
KMU haben dabei einen Vorteil: Ihre Flexibilität. Sie müssen keine starren Strukturen überwinden und können neue Arbeitsformen – wie asynchrone Zusammenarbeit, partizipative Entscheidungen und flexible Arbeitszeiten – leichter einführen.